VIR Stellungnahme zum Digital Fairness Act (DFA)
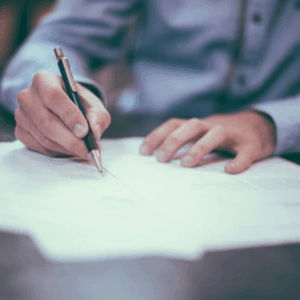 Der Verband Internet Reisevertrieb e. V. (VIR) begrüßt die Möglichkeit, sich im Rahmen der Konsultation der Europäischen Kommission zum Digital Fairness Act (DFA) zu äußern.
Der Verband Internet Reisevertrieb e. V. (VIR) begrüßt die Möglichkeit, sich im Rahmen der Konsultation der Europäischen Kommission zum Digital Fairness Act (DFA) zu äußern.
Die Etablierung vertrauenswürdiger Online-Plattformen stellt ein Schlüsselfaktor für die Weiterentwicklung der gesamten Reisebranche dar. Dabei ist das Ziel, dem Kunden ein passgenaue Angebote zu unterbreiten, die mit den gesetzlichen Vorgaben für digitale Dienste im Einklang stehen.
Kritisch zu bewerten ist jedoch, wenn umfangreiche rechtliche Anforderungen zu erhöhtem Compliance-Aufwand für Unternehmen führen und Informationen aufgrund komplexer juristischer Formulierungen nicht mehr den Informationsbedürfnissen sowie dem Verständnis der Endverbraucher entsprechen. Aus diesem Grund sollte weiterhin der Kunde im Mittelpunkt stehen und der Nutzen für Verbraucher oberste Priorität im Rahmen der Konsultation haben.
Der VIR spricht sich daher dafür aus, die Anstrengungen auf die Stärkung und Modernisierung der bestehenden Vorschriften zu konzentrieren, um eine koordinierte und harmonisierte Durchsetzung der verbraucherschutz- sowie weiterer relevanter Regelungen innerhalb der EU zu gewährleisten.
Es besteht die Befürchtung, dass zusätzliche Maßnahmen zu weiteren Verpflichtungen und Auflagen für Unternehmen führen könnten. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Inhalte der DFA-Konsultation bereits in anderen gesetzlichen Regelungen wie dem Digital Services Act (DSA) oder der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgedeckt sind.
Im Folgenden geht der VIR auf die verschiedenen Aspekte des Fragebogens konkreter ein:
Dark Patterns
Das Thema Dark Patterns wird bereits durch verschiedene EU-Rechtsvorschriften wie die UCPD, die Verbraucherschutzrichtlinie (CRD), die DSGVO und den DSA adressiert. Diese Gesetze enthalten klare Bestimmungen, die irreführende Handlungen, Mehrdeutigkeiten, Verschleierungen, Täuschungen oder Manipulationen von Verbraucherinnen und Verbrauchern untersagen. Darüber hinaus ergänzen der Digital Markets Act (DMA), der AI Act sowie der Data Act dieses Regelwerk durch zusätzliche Vorgaben, sodass ein umfassender rechtlicher Rahmen zur Prävention von Dark Patterns bereits besteht.
Vor dem Hintergrund dieser breiten regulatorischen Abdeckung hält der VIR zusätzliche gesetzgeberische Maßnahmen nicht für erforderlich oder verhältnismäßig. Eine weitere Ausweitung der Regulierung könnte zu erhöhter Komplexität, Unsicherheiten und steigenden Compliance-Kosten führen – mit potenziell negativen Auswirkungen auch für Verbraucherinnen und Verbraucher.
Praktiken wie die Anzeige von Verfügbarkeitsmeldungen, die laut einer Statista-Umfrage von Nutzerinnen und Nutzern als hilfreich wahrgenommen werden, oder die Variation von Farben, Formaten und Schriftarten – die im Wettbewerb Differenzierung ermöglichen – sollten weiterhin zulässig bleiben. Ebenso ist die Anzahl von Klicks bis zur Kaufentscheidung ein wichtiger Aspekt einer nutzerfreundlichen Gestaltung, der nicht pauschal eingeschränkt werden sollte. Ein genereller, unflexibler Ansatz bei der Einordnung von Dark Patterns birgt erhebliche Risiken. Zulässige Marketingaktivitäten, etwa die objektive Darstellung von Angebotsvorteilen, könnten fälschlicherweise als irreführend eingestuft werden. Es ist daher entscheidend zu betonen, dass solche Maßnahmen nicht zwangsläufig eine Irreführung darstellen und daher nicht grundsätzlich untersagt werden sollten. Bereits bestehende Informationspflichten und Gestaltungsvorgaben, beispielsweise zu Button-Beschriftungen, bieten einen angemessenen Schutz für Kundinnen und Kunden.
Anstelle neuer Vorschriften sollte die Europäische Kommission daher bestehende Leitlinien überarbeiten und ergänzende Orientierungshilfen bereitstellen, die aufzeigen, wie die relevanten Rechtsinstrumente (UCPD, CRD, DSA, DMA, DSGVO, KI-Verordnung und Data Act) kohärent und gleichzeitig angewendet werden können.
Suchterzeugendes Design
Online-Plattformen sollten benutzerfreundlich, transparent und ansprechend gestaltet werden. Dabei ist klar zwischen Designmerkmalen zu unterscheiden, die eine effiziente und angenehme Nutzung fördern, und solchen, die potenziell suchtfördernde Elemente beinhalten könnten. Ein pauschales Verbot von Mechanismen, die unter bestimmten Umständen als „suchtfördernd“ gelten könnten, wäre zu restriktiv und würde legitime, nutzerorientierte Gestaltungsstrategien unverhältnismäßig einschränken, ohne zwingend zu einem höheren Maß an Verbraucherschutz zu führen.
Designs, die das Verhalten von Nutzerinnen und Nutzern unzulässig beeinflussen, sind bereits durch bestehende EU-Rechtsinstrumente adressiert und können bei Bedarf sanktioniert werden. So kann ein sogenanntes „addictive design“ als unlautere Geschäftspraxis nach der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (UCPD) eingestuft werden, wenn es die Transaktionsentscheidungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern unangemessen beeinflusst. Ebenso können Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geahndet werden, wenn personenbezogene Daten in diesem Zusammenhang rechtswidrig verarbeitet werden. Eine konsequente Durchsetzung der bestehenden Vorschriften ist daher der zielführendere Weg zu mehr digitaler Fairness, anstatt neue, breit angelegte Regelungen einzuführen.
Mit Blick auf die Integration neuer Technologien – insbesondere Künstlicher Intelligenz in der Kommunikation – gewinnt die Thematik zwar an Bedeutung, sollte jedoch stets differenziert betrachtet werden. Die Reisebranche stellt eine Dienstleistung dar, die nicht regelmäßig in Anspruch genommen wird und daher naturgemäß kein relevantes Suchtrisiko birgt.
Der VIR empfiehlt der Europäischen Kommission, unbeabsichtigte Folgen breit gefasster Anforderungen zu vermeiden und die Vielfalt der Geschäftsmodelle sowie die Eigenarten einzelner Produkte und Dienstleistungen angemessen zu berücksichtigen. Ein übermäßig allgemeiner Ansatz würde die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit digitaler Geschäftsmodelle unnötig beeinträchtigen, ohne einen erkennbaren Mehrwert für Verbraucherinnen und Verbraucher zu schaffen.
Unlautere Personalisierungspraktiken
Personalisierungsmechanismen, Tracking und Profiling können Nutzerinnen und Nutzern erhebliche Vorteile bieten. Sie verbessern die Benutzererfahrung, ermöglichen eine gezieltere Anzeige relevanter Angebote und tragen zur Betrugsprävention bei. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zur Finanzierung vieler digitaler Dienste, indem sie personalisierte Werbung effizienter gestalten und so die Bereitstellung „kostenloser“ Online-Angebote unterstützen. Einschränkungen dieser Technologien könnten daher sowohl für Verbraucherinnen und Verbraucher als auch für Unternehmen nachteilige Auswirkungen haben.
Die Personalisierung ist bereits umfassend durch bestehende EU-Rechtsakte geregelt, darunter UCPD, CRD, DSGVO, DSA, DMA sowie AI Act. Diese Vorschriften adressieren sowohl den Schutz personenbezogener Daten als auch faire Verbraucherinteraktionen. Die DSGVO beschränkt die Verarbeitung sensibler Daten konsequent, der DSA untersagt Profiling auf Grundlage solcher Daten und verpflichtet Online-Plattformen zu Transparenz bei Werbung. Der modernisierte CRD regelt zudem, dass Verbraucherinnen und Verbraucher informiert werden müssen, wenn Preise mithilfe automatisierter Entscheidungsprozesse personalisiert werden.
Die eigentliche Herausforderung liegt weniger in regulatorischen Lücken als vielmehr in uneinheitlichen Auslegungen und fehlender Klarheit, wie die bestehenden Rechtsakte ineinandergreifen. Es ist daher entscheidend, dass rechtmäßige Personalisierung und dynamische Preisgestaltung klar voneinander abgegrenzt werden. Behörden sollten ausdrücklich anerkennen, dass angebot- und nachfragebasierte (dynamische) Preisbildung sowie zulässige Formen der Personalisierung, etwa gezielte Rabattangebote für bestimmte Kundengruppen, legitime und wettbewerbsfördernde Praktiken darstellen – sofern sie im Einklang mit geltendem Recht stehen.
Daraus lässt sich ableiten, dass bereits ein umfassender rechtlicher Rahmen existiert, der sowohl Kundinnen und Kunden Kontrolle über personalisierte Angebote gibt als auch Unternehmen Planungssicherheit bietet. Zusätzliche Regelungen würden die Situation unnötig verkomplizieren und die Innovationsfähigkeit digitaler Geschäftsmodelle beeinträchtigen, ohne einen erkennbaren Mehrwert für den Verbraucherschutz zu schaffen.
Irreführendes Marketing im Zusammenhang mit der Preisgestaltung
Wie bereits ausgeführt, existieren auf EU-Ebene umfassende regulatorische Vorgaben zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor irreführenden oder unlauteren Praktiken bei der Preisgestaltung. Insbesondere die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (UCPD), die Verbraucherrechte-Richtlinie (CRD) und die Preisangabenrichtlinie verpflichten Händler, den Gesamtpreis zum Zeitpunkt des Kaufs klar und transparent darzustellen. Ergänzend enthält die derzeit überarbeitete Luftverkehrsverordnung spezifische Transparenzanforderungen für Flugpreise.
Vorrang sollte daher eine koordinierte und harmonisierte Durchsetzung der bestehenden Regelungen haben, nicht die Einführung neuer gesetzlicher Bestimmungen. Zusätzliche Regulierungsschritte würden voraussichtlich keine Verbesserungen für den Verbraucherschutz bringen, sondern vielmehr zu Unsicherheit und erhöhter Komplexität führen.
Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass es legitime und unvermeidbare Situationen gibt, in denen nicht alle Preisbestandteile im Voraus exakt angegeben werden können. Im Tourismussektor betrifft dies etwa lokale Kur- oder Ortstaxen sowie Tourismusabgaben, deren Höhe von kommunalen Entscheidungen abhängt und im Vorfeld nicht präzise kalkulierbar ist. Ebenso kann der Endpreis während des Buchungsprozesses durch individuelle Kundenentscheidungen – etwa Zusatzleistungen oder optionale Servicebuchungen – angepasst werden. Diese Fälle sind klar von irreführenden oder unlauteren Praktiken zu unterscheiden.
Die dynamische Preisgestaltung nimmt je nach Branche und Geschäftsmodell unterschiedliche Ausprägungen an und ist ein wesentlicher Bestandteil moderner, wettbewerbsorientierter Märkte. Sowohl Unternehmen als auch Verbraucherinnen und Verbraucher können von dieser Flexibilität profitieren. Zu den Vorteilen zählen eine effizientere Ressourcenallokation, potenziell niedrigere Verbraucherpreise, die Stärkung des Wettbewerbs, eine erleichterte Markteintrittsdynamik neuer Anbieter sowie eine verbesserte Bestandsverwaltung.
Ein pauschales Verbot oder eine übermäßige Einschränkung dynamischer Preisgestaltung wäre daher unverhältnismäßig. Der VIR befürwortet ausdrücklich, dass Unternehmen ihre Preise im Rahmen der geltenden Gesetze und Verordnungen dynamisch und transparent anpassen können, sofern sie dabei ihren Informationspflichten nachkommen und keine irreführenden Methoden anwenden.
Bereichsübergreifende Themen
Um die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die Rechtssicherheit zu gewährleisten, empfiehlt der VIR die Überprüfung folgender Konzepte.
1. Begriff „Schutzbedürftige Verbraucher“
Die klare Definition von „schutzbedürftigen“ und „durchschnittlichen“ Verbrauchern ist wesentlich für die Rechtssicherheit und Politikgestaltung. Änderungen am Standard des Durchschnittsverbrauchers beeinflussen Auslegung, Durchsetzung und Stabilität bestehender Vorschriften. Der Begriff des schutzbedürftigen Verbrauchers findet bereits Anwendung in zentralen Gesetzen wie DSGVO und DSA. Eine Erweiterung um unscharfe Begriffe wie „emotionale Belastung“ könnte die Klarheit gefährden und zu mehr Datenverarbeitung führen, was im Konflikt mit der DSGVO steht. Stattdessen sollte der Fokus auf klar definierte Risikogruppen wie Minderjährige und einen risikobasierten Ansatz gelegt werden.
2. Beweislast und „Fairness by Design“
Die Umkehrung der Beweislast sorgt für Rechtsunsicherheit und höhere Kosten und widerspricht der Verhältnismäßigkeit. Effektiver wäre es, Behörden mit den nötigen Werkzeugen zur Kontrolle auszustatten. Gerade angesichts des EU-Ziels, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, sollte Unternehmen kein unnötiges Risiko auferlegt werden. Das Prinzip „Fairness by Design“ ist unklar formuliert und schafft Interpretationsspielräume. Verbraucherrechte werden bereits bei der Produktentwicklung berücksichtigt, sodass der zusätzliche Nutzen zweifelhaft bleibt. Zielführender sind klare, durchsetzbare und vorhersehbare gesetzliche Vorgaben.
Schlussbemerkung
Abschließend ist festzuhalten, dass digitale Geschäftsmodelle in vielfältiger Form existieren und jeweils spezifische Herausforderungen mit sich bringen. Im Rahmen einer Überarbeitung des Verbraucherrechts sollte dieser Vielfalt Rechnung getragen werden – mit dem Ziel, Komplexität zu reduzieren und unnötige Belastungen zu vermeiden.
Angesichts der jüngsten Regulierungswelle (etwa DSA, DMA und KI-Verordnung) sollte zunächst Zeit gegeben werden, damit diese Regelwerke ihre Wirkung entfalten können, bevor neue gesetzgeberische Schritte erwogen werden. Wo erforderlich, können praxisnahe, harmonisierte Leitlinien eine einheitliche und effektive Umsetzung erleichtern und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen stärken.
Anstatt das bestehende Verbraucherrecht grundlegend neu zu gestalten, bietet sich die Gelegenheit, überlappende Informationspflichten zu straffen und in kompakte, gestufte Kerninformationen zu bündeln. Intuitive digitale Darstellungsformen – etwa Symbole, ausklappbare Abschnitte oder klare visuelle Hervorhebungen – können die Nutzerfreundlichkeit erhöhen, ohne den Informationsgehalt zu mindern.
Der VIR befürwortet daher eine zielgerichtete, evidenzbasierte und verhältnismäßige Regulierung, die das Verhältnis zwischen Risiko und Verbraucherschutz sorgfältig austariert und unbeabsichtigte Folgen vermeidet, welche die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der EU beeinträchtigen könnten.
Über den VIR:
Der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) ist seit über 20 Jahren die zentrale Stimme der digitalen Touristik in Deutschland. Seine mehr als 90 Mitgliedsunternehmen zählen zu den führenden Akteuren des digitalen Reisevertriebs – darunter etablierte Online-Reiseportale, Reiseveranstalter, Technologieanbieter und innovative Start-ups. Laut den FUR-Zahlen von 2025 werden rund 74 Prozent der VerbraucherInnen bei Reisen ab einer Übernachtung mindestens eine Reiseleistung digital gebucht. Der VIR vertritt die Interessen der Branche gegenüber Politik, Medien und VerbraucherInnen, fördert Innovationen und Nachwuchs und sensibilisiert die Touristik für die Zukunftsthemen der Digitalisierung.
VIR-Mitglieder sind:
1-CP, A3M, ACCON-RVS, adigi, AERTiCKET, Allianz Travel, Amadeus Germany, Berge & Meer, audio solutions, Bewotec, Booking.com, .BOSYS, BPCS Consulting Services, CampNerd, CFM, Chain4Travel, DERTOUR Group, EC Travel, elysium, ERGO Reiseversicherung, Europ Assistance, Evaneos, expipoint, Expedia Group, fanz, FerienDiscounter, Flyla, For You Travel, GIATA, GOVOYAGE, Hamburg Tourismus, HanseMerkur, HolidayCheck, holidayheroes, holidays2market, honeepot, HRS, Invia Group, Involatus Carrier Consulting, journaway, Juvigo, LEGOLAND Holidays, Mastercard, Midoco Group, NewTravel, Nomady, OBS OnlineBuchungsService, onlinejungle.camp, OPINSTAR, Passolution, Payone, PayPal, Peakwork, Sabre, schauinsland-reisen, solamento, Stadt und Land Reisen, Sunny Cars, taa travel agency accounting, ta.ts, team neusta, traffics, TraSo, travelbasys, Travel Data & Analytics (TDA), Travelport, TripPika, TURESPAÑA, ViralSpoon, vJourney, Voyage Privé, We Love Holidays Deutschland, weg.de, WIIF, Wirelane, worcay, Worldpay, WorldTransfer, Xamine und ZAUBAR.
Lesen Sie mehr News
Wir informieren Sie über aktuelle Themen von und für die Touristik.
Alle Beiträge finden Sie in unserem News-Bereich aufgelistet. Oder wählen Sie aus unseren News-Kategorien einen Themenbereich und lesen Sie nur die jeweiligen Themenbeiträge.

